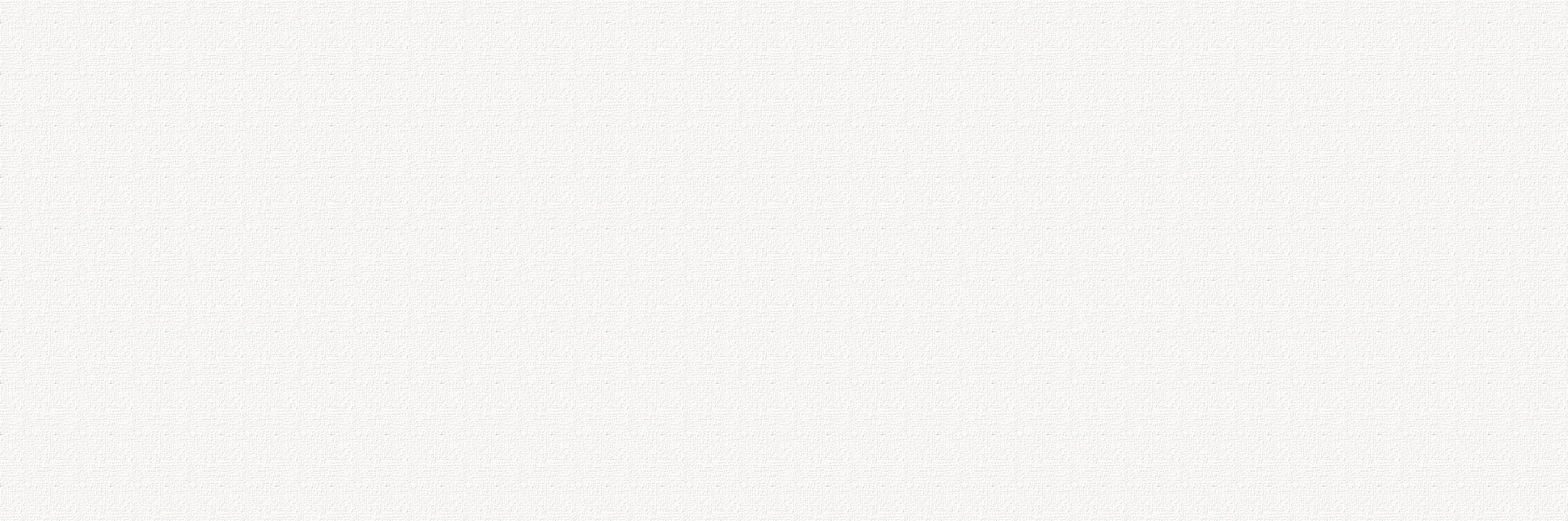Kennst du das Gefühl, dass du innerlich kochst – obwohl du doch eigentlich ruhig bleiben wolltest? Oder dass du nach einem anstrengenden Tag hundemüde ins Bett fällst – um dann doch nicht einschlafen zu können, weil dein Kopfkino jetzt erst so richtig aufdreht? In solchen Momenten zeigt sich oft, wie gut wir uns selbst regulieren können.
Doch was genau bedeutet eigentlich Selbstregulation? Weshalb ist sie (nicht nur) im pädagogischen Alltag unerlässlich? Und woran erkennst du, wie gut deine Selbstregulation ist? Okay, lass uns mal ein bisschen in das Thema hineinzoomen.
Was ist selbstregulation?
Der kanadische Psychologe Albert Bandura beschreibt Selbstregulation so: Wir Menschen verfügen über Fähigkeiten, die uns eine gewisse Kontrolle über unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen ermöglichen.[1] Wir sind also keine Wetterfahnen, die im Wind flattern, sondern können unserem Leben unsere eigene Richtung geben.
Was das heißt, zeigt sich oft in Alltagsmomenten: Wenn du tief durchatmest, bevor du auf den provozierenden Kommentar einer Kollegin eingehst. Wenn du merkst, dass die vielen Anforderungen dich zu überrollen scheinen und du eine Grenze setzt: „Stopp. Ich brauche jetzt eine Pause.“
Selbstregulation zeigt sich auch in größeren Entscheidungen. Etwa, wenn du spürst, dass du in deinem Berufsfeld dauerhaft überfordert bist und dich bewusst entscheidest, etwas zu verändern: eine Fortbildung zu machen, die Schule oder Kita zu wechseln, ein Sabbatical zu beantragen, dir externe Unterstützung zu holen. Auch das ist Selbstregulation – weil du deine inneren Signale wahrnimmst und ihnen bewusst eine Richtung gibst.
Die Rolle des Nervensystems
In den letzten Jahren hat sich das Verständnis von Selbstregulation erweitert, dank Erkenntnissen aus der Neurobiologie und der Körperpsychotherapie. Beide sind sich einig: Selbstregulation ist nicht nur Kopfsache, bei der es vor allem aufs Denken, Planen, Entscheiden ankommt. Selbstregulation ist untrennbar mit unserem Nervensystem verbunden.
Wenn du eine Gefahr wahrnimmst – und das kann schon der hohe Lärmpegel im Gruppenraum sein oder die harsche Kritik der Kollegin – dann schaltet das autonome Nervensystem unmittelbar in alte Schutzprogramme: Du bekommt womöglich einen roten Kopf, schimpfst oder flüchtest aus der Situation.
Das sind Verhaltensweisen, die oft automatisch und blitzschnell ablaufen: Sie gehören zu den verschiedenen Stressreaktionen. Welche es gibt und welche Verhaltensweisen ganz typisch sind, habe ich in meinem Beitrag zu den Stressreaktionen ausführlich beschrieben.
Diese Stressreaktionen „überstimmen“ dann vorübergehend die bewusste Regulation oder machen sie zumindest deutlich schwerer. Im Grunde genommen sind Stressreaktionen auch eine Form von Selbstregulation – jedoch auf einer sehr willkürlichen und automatischen Ebene. Sie sind der Versuch deines Nervensystems, deine Reaktion an die aktuelle Anforderung anzupassen, so dass du handlungsfähig bleibst.
Die Sache hat jedoch einen Haken: Stressreaktionen folgen meistens festen und ziemlich starren Mustern. Sie sind unreflektiert und automatisiert. Gut möglich, dass du damit also übers Ziel hinausschießt oder das Gegenteil dessen erreichst, was dir wichtig wäre.
Wenn du deine Selbstregulation stärkst, kannst du in solchen Momenten adaptierter reagieren: Du nimmst deutlicher wahr, was im eigenen „System“ passiert. Du steuerst deine Impulse bewusster und findest schneller zurück in einen gut regulierten Zustand.
«Selbstregulation bedeutet, mit dem „eigenen System“ in Kontakt zu sein.»
Was ich damit meine? Du bist in Kontakt mit deinen Gedanken, deinen Gefühlen und deinen Körperempfindungen. Du nimmst deine Innenwelt wahr.
Ein komplexes Zusammenspiel
Selbstregulation umfasst also einerseits die bewusste Steuerung – zum Beispiel Impulskontrolle oder Aufmerksamkeitssteuerung – und andererseits körperliche Regulationsprozesse, die meist automatisch ablaufen – etwa Atmung, Herzfrequenz oder Muskelspannung.
Auch diese körperlichen Prozesse kannst du beeinflussen, selbst wenn vieles automatisch passiert. Doch über Atmung, Bewegung, Körperwahrnehmung oder auch Berührung wirkst du regulierend auf dein autonomes Nervensystem ein.
Du merkst vielleicht: Wenn man Selbstregulation beschreiben will, stößt man schnell an Grenzen – weil sie etwas sehr Ganzheitliches ist. Ich mag deshalb folgende Definition besonders gern, weil sie Kopf und Körper mitdenkt:
„Sich selbst regulieren zu können, umfasst die Fähigkeit, eigene innere Zustände, also hauptsächlich Gefühle und Spannungszustände herzustellen und aufrechtzuerhalten (…) – und damit auch die begleitenden physiologischen Prozesse und Verhaltensweisen zu regulieren.“[2]
Genau das trifft den Kern. Selbstregulation ist kein rein mentaler Akt. Sie ist das Zusammenspiel zwischen Körper, Emotion und Kognition.

Warum Selbstregulation im pädagogischen Alltag unerlässlich ist
Selbstregulation ist für Pädagog:innen weit mehr als nur eine persönliche Fähigkeit – sie eine professionelle Schlüsselkompetenz. Denn ob Schule, Kita, Beratungsstelle oder Wohngruppe: In kaum einem anderen Berufsfeld sind Menschen so dauerhaft mit emotionalen Anforderungen, Beziehungsarbeit und Unvorhersehbarem konfrontiert. Kinder, Jugendliche, Klient:innen reagieren nicht nach Plan – sie bringen ihre eigenen Geschichten und Stimmungen mit. In vielen Momenten entscheidet nicht dein Fachwissen allein darüber, wie eine Situation verläuft – sondern deine Fähigkeit, reguliert zu bleiben.
Hier mal ein paar Beispiele, wie Selbstregulation im Alltag ganz praktisch aussehen kann:
- In der Teamsitzung wirst du von einem Kollegen kritisiert. Statt dich in einer Rechtfertigungsschleife zu verlieren, hältst du zunächst inne, reflektierst kurz und entscheidest, welchen Teil der Kritik du vielleicht annehmen willst – oder auch nicht. Du antwortest konstruktiv statt defensiv zu werden.
- Deine sorgfältig geplante Unterrichtsstunde beginnt damit, dass das Whiteboard mal wieder abschmiert. Nach einem kurzen Frustmoment, in dem dein Herz schneller schlägt und du „miese Technik“ fluchst, entspannst du dich und findest eine andere Lösung, statt im „Blöde-Technik-Frust“ steckenzubleiben.
- Deine Kollegin bedient sich zum wiederholten Mal ungefragt an deinem Materialfundus. Statt deinen Ärger mit einem „Ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, ich übertreibe vielleicht auch einfach“ wegzulächeln, nimmst du deine Reaktionen wahr, schenkst ihnen Beachtung und Glaubwürdigkeit (und sprichst deine Kollegin später an).
Wenn du dich gut regulieren kannst, dann bleibst du handlungsfähig: Statt unreflektiert und automatisch zu reagieren, bist du in der Lage, dein Verhalten bewusst zu gestalten. Du kannst deine Haltung bewahren, deine Empathie behalten und gleichzeitig Grenzen setzen, ohne unmittelbar in Ärger, Rückzug oder Überforderung zu kippen.
Du brauchst Selbstregulation jedoch nicht nur, um „ruhig zu bleiben“ oder dich nach einer stressigen Situation wieder zu beruhigen. Das ist nur die halbe Miete. Denn deine Selbstregulation sorgt ja vor allem dafür, dass du insgesamt handlungsfähig bleibst: Und das kann eben auch heißen, dass du dich „entruhigst“ – zum Beispiel, indem du Abgrenzungsenergie aufbringst oder dich aufrichtest, um deinen Worten Nachdruck zu verleihen.
Selbstregulation als Schlüsselkompetenz
Ohne Selbstregulation übernimmt häufig das autonome Nervensystem die Regie:
Wir reagieren automatisch, statt bewusst zu handeln. Im pädagogischen Alltag heißt das dann vielleicht: Statt einem Kind in seiner Überforderung zugewandt zu begegnen, reagieren wir gereizt oder ziehen uns innerlich zurück.
Wenn wir gut reguliert sind, dann können wir:
- unsere Wahrnehmung offenhalten: wir sehen nicht nur das Verhalten, sondern auch das Bedürfnis dahinter
- klar und deutlich kommunizieren – statt uns defensiv, passiv-aggressiv oder auch gar nicht zu äußern
- unsere innere Ruhe wiederherstellen, wenn wir uns verunsichert oder verärgert fühlen
- Beziehungen gestalten, die auf Sicherheit und echter Verbindung beruhen
Selbstregulation ist eine Schlüsselkompetenz – nicht nur im pädagogischen Alltag. Wir brauchen sie für ein gelingendes Leben. Denn Selbstregulation schützt uns vor psychischen Belastungen. Menschen, die sich gut regulieren können, leiden zum Beispiel seltener unter Angstzuständen oder hohem Stress.[3] Eine gute Selbstregulation unterstützt uns außerdem dabei, unsere negativen Gedankenmuster zu erkennen und zu verändern. Sie stabilisiert die Stimmung und kann depressive Symptome verringern.[4]
Wir wissen auch, dass Kinder, die sich gut regulieren können, als Erwachsene eine bessere psychische Gesundheit haben: Suchterkrankungen, Depressionen oder Angststörungen treten bei ihnen seltener auf.[5]
Selbstregulation ist daher eine lebenswichtige Kompetenz, die viel für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden tut.
selbstregulation und resilienz
Wenn Resilienz ein Haus wäre, dann wäre Selbstregulation das Fundament. Ich bin keine Häuslebauerin, doch auch so weiß ich: Ein solides Fundament entscheidet darüber, wie langlebig und stabil das Bauwerk am Ende wird.
Und wenn das Fundament bröckelt, dann helfen auch die schönsten, liebevoll mit Kreide verputzten Wände nicht viel.
So ähnlich ist es mit unserer Resilienz. Wenn unsere Selbstregulation wackelig ist, dann wird es mit unserer Resilienz schwierig. Du erinnerst dich: Resilienz ist das, was allgemein „psychische Widerstandskraft“ genannt wird. Sie sorgt dafür, dass du Belastungen abpuffern kannst und dich nach einer Krise oder einer herausfordernden Situation rasch wieder zurück in deine Balance bringst.

Das Herzstück von Resilienz
Selbstregulation ist das Fundament dafür, dass die anderen Resilienzkompetenzen – wie Optimismus oder Netzwerkorientierung – gut greifen können. Denn wenn du dich in einem Zustand höchster Anspannung befindest, ist dein Zugang zu diesen anderen Kompetenzen oft blockiert. Wenn dein Nervensystem Alarm schlägt, ist es damit beschäftigt, dich in Sicherheit zu bringen. Dein Optimismus in dem Moment? Irgendwo – doch gerade nicht bei dir. Deine Netzwerkorientierung? Die kann dich womöglich kaum erreichen.
Wenn dein autonomes Nervensystem hingegen wieder regulierter ist – das heißt noch nicht, dass es total gut reguliert sein muss –, dann öffnet sich die Tür zu den anderen Resilienzkompetenzen. Dann kannst du Optimismus wieder fühlen, kreative Lösungen finden oder auf andere Menschen zugehen.
Selbstregulation spielt daher zu recht in verschiedenen Resilienzmodellen eine wichtige Rolle und gilt als Voraussetzung für eine hohe Resilienz. Oder anders ausgedrückt: Selbstregulation ist das Herzstück von Resilienz.
Der Mythos der „Unkaputtbarkeit“
Resilienz heißt übrigens nicht, unkaputtbar zu sein und sich immer mehr Belastungen draufzupacken. Resilient zu sein, bedeutet vor allem, mit sich selbst in Kontakt zu bleiben und die eigenen Ressourcen wahrzunehmen (und zu differenzieren, wann man lieber die Reißleine ziehen sollte, statt die Zähne zusammenzubeißen).
Deine Selbstregulation macht es möglich, dass du die Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen, bewusst mobilisierst: Du erkennst, wann du Unterstützung brauchst, du erkennst, wann du eine Pause einlegen solltest, du erkennst, was deine körperlichen Reaktionen dir sagen wollen, du erkennst, ob du dich in einer Situation beruhigen oder Energie zum „Entruhigen“ einsetzen solltest. In einem Satz: Wenn du gut reguliert bist, hältst du das Steuerrad deines Lebens selbst in der Hand.
Vielleicht nicht perfekt. Doch statt dich fremdbestimmt oder wie ferngesteuert zu fühlen, hast du das Gefühl, dein Leben aktiv gestalten zu können.
Woran erkennst du, wie gut du reguliert bist?
Ich habe dir mal eine kleine „Checkliste“ erstellt. Frage dich gern: Wie sehr stimmst du diesen Aussagen zu?
Wenn du über eine gute Selbstregulation verfügst, dann:
- nimmst du deine Gefühle wahr (und fühlst dich nicht einfach nur „gut“ oder „schlecht“, sondern kannst differenzierter wahrnehmen, was in dir los ist)
- kannst du Gefühle in dir „halten“, sie eine Weile da sein lassen, statt sie zu unterdrücken
- spürst du Körperempfindungen und innere Reize deutlich – z. B. Atmung, Muskelspannung, Herzschlag, Temperaturunterschiede, Enge und Weite, Druck und Weichheit
- bist du präsent und mit deiner Aufmerksamkeit die meiste Zeit im Hier und Jetzt (statt häufig über die Vergangenheit zu grübeln oder dich über die Zukunft zu sorgen)
- nimmst du deine Grenzen wahr und kannst dich nach außen abgrenzen ohne starke Schuldgefühle (die deine Bemühungen womöglich wieder zunichte machen)
- kannst du dich selbst beruhigen und deine Reaktion auf Stress positiv beeinflussen

Selbstregulation: eine Momentaufnahme
Heißt das nun, dass du in jedem Moment deines Lebens gut reguliert sein musst?
Das wäre ein total unmögliches Vorhaben, weil wir nun mal menschliche Wesen sind. Vielleicht bekommst du in deiner momentanen Lebensphase chronisch zu wenig Schlaf. Oder du hast beruflich gerade eine besonders herausfordernde Zeit. Wenn du also dauerhaft unter Druck stehst und mit hoher Stressbelastung durchs Leben gehst, dann ist Selbstregulation schwieriger.
Dein Nervensystem reagiert fortlaufend auf äußere und innere Reize. Das bedeutet: Selbstregulation ist kein Ziel, das du erreichst – und fertig. Sie ist ein dynamischer Prozess. Du bist also nicht einmal reguliert und bleibst es dann.
Stelle dir deine Selbstregulation wie ein Spektrum vor, auf dem du dich zwischen Anspannung und Entspannung bewegst. Schwankungen sind also kein „Fehler“. Sie sind ein natürlicher und sogar notwendiger Teil einer lebendigen Selbstregulation: Das Nervensystem ist dafür gemacht, mit Auf und Abs flexibel umzugehen. Wenn du eine gute Selbstregulation hast, dann hast du die Fähigkeit, wieder ins Gleichgewicht zu kommen – statt dauerhaft in einem Auf oder Ab „steckenzubleiben“.
Was beeinflusst die Selbstregulation?
Wie gut du dich regulieren kannst, hängt von vielen Dingen ab. Auf diese haben wir nicht immer unmittelbar Einfluss: Wie gut du dich regulieren kannst, hat zum Beispiel mit deiner allgemeinen Gesundheit zu tun, mit deiner Schlafqualität, mit hormonellen Veränderungen, mit deiner Ernährung und vielem mehr.
Daher mache ich selbst regelmäßig einen simplen Check-in bei mir und frage mich:
Wie steht es gerade um meine physiologischen Bedürfnisse?
Habe ich ausreichend geschlafen?
Mich genug bewegt?
Habe ich Zeit an der frischen Luft verbracht?.
Diese simplen Dinge vergessen wir schnell. Wir suchen dann nach Regulationstools, statt uns um unsere basalen Grundbedürfnisse zu kümmern. Du kennst das vielleicht: Wenn dein Magen in den Kniekehlen hängt und dein Blutzucker Achterbahn fährt, fällt es schwer, geduldig mit den lieben Mitmenschen zu sein und die eigenen Emotionen zu regulieren. Daher: Checke die Basis.
Doch nicht nur dein aktueller Zustand beeinflusst, wie gut du dich regulierst. Die Grundlage für deine Selbstregulation liegt nicht in der Gegenwart, sondern in der Vergangenheit: Deine frühesten Erfahrungen in der Kindheit spielen eine große Rolle. Die Grundlage der Selbstregulation wird bereits in den ersten drei Lebensjahren geprägt.
Es war einmal … die Kindheit
Wir kommen als „unfertige“ Wesen auf die Welt. Das heißt, wir sind auf unsere Bezugspersonen angewiesen. Ohne sie könnten wir nicht überleben. Und wir können uns zunächst auch nicht selbst regulieren, sondern sind auf die Erwachsenen angewiesen, die sich um uns kümmern. Entscheidend für die Entwicklung unserer Selbstregulation ist daher, wie feinfühlig unsere Bezugspersonen auf unsere Signale reagieren.
Wir brauchen Bezugspersonen, die unsere Gefühle spiegeln – zum Beispiel durch Tonfall oder Mimik – und die uns helfen, mit überwältigenden Gefühlen umzugehen. Das fängt allein damit an, dass sie auf unser Weinen oder Schreien reagieren (denn anders können wir zunächst nicht auf uns aufmerksam machen). Wenn wir also erleben: „Da ist jemand verlässlich für mich da“, dann entwickeln wir auf Basis dieser inneren Sicherheit die Fähigkeit zur Selbstregulation. Während wir anfangs zwingend auf die externe Regulation angewiesen sind, können wir im Verlauf der Kindheit und Jugend nach und nach die interne Fähigkeit entwickeln, uns selbst zu „halten“.
Erfahren wir als Babys und Kinder nicht die nötige Co-Regulation, erhöht sich das Risiko für langfristige Regulationsschwierigkeiten und eine höhere Stressanfälligkeit. Wenn wir über längere Zeit zu wenig (oder keine) emotionale Unterstützung und Sicherheit erfahren, kann dieser Mangel zu einem Entwicklungstrauma führen.
Entwicklungstrauma entstehen unter anderem, wenn wir als Baby viel allein gelassen wurden, bei emotional „nicht verfügbaren“ Bezugspersonen aufwuchsen oder wenig Körperkontakt hatten. Diese Erfahrungen wirken auf das Nervensystem und verändern, wie gut wir uns regulieren können. So haben Menschen mit Entwicklungstrauma oft ein sensitiveres Stresssystem, das leichter auf Reize reagiert und schneller Gefahr wittert. Doch auch, wenn Co-Regulation in der Kindheit gefehlt hat, können positive Erfahrungen später im Leben – stabile Beziehungen, achtsame Unterstützung von anderen – die Selbstregulation „nachnähren.“

Co-Regulation: Wir regulieren uns nicht nur allein
Doch auch, wenn wir uns als Erwachsene zunehmend selbst regulieren können: Wir bleiben auf die Regulation durch andere angewiesen. Als soziale Wesen sind wir darauf programmiert, über Beziehungen zu anderen Menschen Sicherheit und Stabilität zu erfahren.
Dabei folgt die „erwachsene“ Co-Regulation denselben Prinzipien wie in unserer Kindheit: Wir brauchen andere Menschen, die empathisch mit uns mitschwingen. Die uns Sicherheit und Orientierung bieten. Das kann ein gemeinsames tiefes Durchatmen sein. Eine Umarmung. Oder das aktive Zuhören, bei dem unser Gegenüber uns zeigt: „Ich nehme mir Zeit und höre dir zu.“ Bereits die Gewissheit, dass es andere Personen gibt, die für einen da sind, reguliert das Nervensystem.
Für Pädagog:innen heißt das: Wenn du zentriert und mit dir selbst in Kontakt bist, bietest du den Menschen in deinem Umfeld die Möglichkeit, sich mitzuregulieren. Ein Kind ist aufgebracht – und indem du bewusst ruhig bleibst, durchatmest und in klarem, empathischem Tonfall reagierst, bietest du dem Kind die Chance, die eigene Erregung abzubauen. Somit wird Selbstregulation nicht nur zur Voraussetzung für deine Arbeit, sondern zu einer stillen und hochwirksamen Form pädagogischen Handelns.
Co-Regulation passiert oft automatisch und unmittelbar. Wer diese Dynamik kennt und nutzt, kann sowohl die eigene als auch die Resilienz von anderen Menschen fördern. Dazu braucht es oft nicht viel: ein kurzer Austausch in der Teeküche, ein beruhigendes Wort nach einer hitzigen Situation auf dem Schulhof, ein verstehendes Lächeln auf dem Flur.

der unterschied zwischen selbstregulation und selbstkontrolle
Selbstregulation wird oft mit „Selbstkontrolle“ verwechselt. Dabei handelt es sich zwar um verwandte Konzepte, die sich jedoch deutlich unterscheiden. Selbstkontrolle setzt eine bewusste Entscheidung von dir voraus[6]. Du nimmst dir zum Beispiel bewusst vor, dich gesünder zu ernähren und die Tüte Weingummi am Abend ausfallen zu lassen. Selbstkontrolle hilft dir also dabei, dich zu disziplinieren – und zwar entgegen anderen Vorlieben (denn du liebst Weingummi).
Du merkst vielleicht beim Lesen: Selbstkontrolle klingt recht anstrengend. Ja, das ist sie oft. Denn du musst mentale Kapazitäten aufwenden, um selbstkontrolliert zu handeln. Das ist auch der Grund, weshalb wir Selbstkontrolle nicht unendlich lange aufrechterhalten können.
Für mich ist Selbstkontrolle vergleichbar mit einem Sprint: Um ein kurzfristiges Ziel zu erreichen, kann sie sehr wichtig sein. Wenn ich mich auf ein heikles Beratungsgespräch am nächsten Tag vorbereiten möchte, hilft mir Selbstkontrolle dabei, dranzubleiben – auch wenn mich meine Freundin anruft, weil sie abends spontan mit mir etwas trinken will. Durch Selbstkontrolle bin ich in der Lage, dem Impuls nach einem Pinot Noir mit meiner Freundin zu widerstehen. Doch nach dem Beratungsgespräch, da darf die Selbstkontrolle auch wieder in der Kommode verschwinden.
wie kannst du deine selbstregulation fördern?
Wie ich beschrieben habe, ist Selbstregulation nichts, was man einmal „erreicht hat“ und dann abhakt. Sie ist eine Kompetenz und ein Prozess – das heißt, du kannst sie durch Übung und Selbstreflexion immer wieder nähren.
Dabei sind es oft die scheinbar simplen Dinge, die guttun und hilfreich sind. Ich stelle dir drei Impulse vor, auf die ich selbst regelmäßig zurückgreife.
#1: Atme bewusst
Ein wunderbar wirksamer Einstieg kann über deine Atmung erfolgen. Du kannst mit deinem autonomen Nervensystem nicht über Worte kommunizieren, doch es versteht die „Sprache“ deiner Atmung. Bereits ein, zwei bewusste Atemzüge können es beruhigen.
Achte dabei vor allem auf zwei Dinge: Atme möglichst durch die Nase. Und atme etwas länger aus als du einatmest. Baue diese Atmung jeden Tag mehrmals in deinen Alltag ein. Unter der Dusche. Während du dir Kaffee kochst. Während du Berichte schreibst. Vorm Einschlafen. Die verlängerte Ausatmung aktiviert dein parasympathisches Nervensystem – den Zweig deines Nervensystems, der für Sicherheit und Entspannung zuständig ist.
#2: Bodenkontakt
Eine weitere einfache Möglichkeit: Spüre mal bewusst den Boden unter dir. Stelle deine Füße nebeneinander und nimm bewusst wahr, wie sie den Boden berühren. Diese kleine Rückverbindung kann überraschend stabilisierend wirken.
Durch den Bodenkontakt wird deine Propriozeption angeregt. Die Propriozeption wird auch als „6. Sinn“ bezeichnet – sie liefert dem Gehirn ständig Rückmeldungen darüber, wo sich dein Körper im Raum befindet und wie viel Spannung oder Druck in deinen Muskeln und Gelenken herrscht. Diese Informationen schaffen ein Gefühl von Orientierung und innerer Stabilität. Für die Selbstregulation ist das entscheidend, weil propriozeptive Reize – etwa durch Bodenkontakt, Bewegung oder Dehnung – das Nervensystem beruhigen und Sicherheit vermitteln können. In meiner Resilienz-Stunde Selbstwahrnehmung gehe ich noch näher darauf ein.
Wenn du dagegen häufiger mit überschlagenen Beinen sitzt, schränkst du diesen Bodenkontakt und die gleichmäßige Erdung ein. Das kann dazu führen, dass du weniger sensorischen Input von beiden Füßen bekommst – also weniger Signale von Stabilität und Gleichgewicht. Daher nehme ich mir zum Beispiel jeden Tag bewusst einen (oder mehrere) kurze Momente, in denen ich die Füße parallel auf den Boden stelle und den Bodenkontakt bewusst wahrnehme (So wie gerade beim Tippen dieser Zeilen, weil mein Blogprogramm mich anscheinend in den Wahnsinn treiben will mit merkwürdigen Formatierungsmacken). Besonders in Stresssituationen kann es daher hilfreich sein, Bodenkontakt zu spüren und ein paar Atemzüge lang zu merken: Ich bin hier. Ich bin sicher. Der Boden trägt mich.
#3: Reflektiere dich selbst
Hole auch deinen Verstand mit ins Boot. Für Selbstregulation brauchen wir auch Selbstreflexion. Wir können nur regulieren, was wir auch wahrnehmen. Oft reagieren wir in bestimmten Situationen immer wieder auf eine ähnliche Art und Weise: Wir werden gereizt, ziehen uns zurück oder sind im Funktioniermodus unterwegs. Dahinter stecken häufig alte Muster und Überzeugungen, die uns steuern, ohne dass wir es merken.
Du nimmst dir zum Beispiel fest vor, gelassen zu bleiben – doch sobald deine Kollegin dich kritisiert, merkst du, wie dein Körper anspannt und deine Stimme schärfer wird. Von innerer Gelassenheit keine Spur. Diese Reaktion ist kein Versagen, sondern ein Hinweis – auf etwas, das unter der Wasseroberfläche wirkt.
Diese Reflexionsfragen unterstützen dich dabei, dich besser kennenzulernen:
„Woran merke ich, wenn ich angespannt bin?“
„Welche Signale schickt mir mein Körper, dass ich aus dem Gleichgewicht geraten bin?“
„Wodurch nehme ich wahr, dass ich mich gerade gut reguliert fühle?“
Diese Impulse sind kleine Einladungen, um dir Unbewusstes bewusst zu machen.
Abschließend habe ich noch einen Impuls für dich, wenn du gern gemeinsam mit mir und anderen „unter die Wasseroberfläche“ tauchen willst: In meinem Kurs Roots of Your Resilience gehen wir genau dorthin – wir erkunden, welche inneren Dynamiken deine Fähigkeit zur Selbstregulation beeinflussen. Du lernst, dein Stress-Toleranzfenster besser zu verstehen, selbstsabotierende Glaubenssätze zu erkennen und liebevoll zu regulieren sowie dein Verständnis für Emotionen zu erweitern.

Selbstregulation kann auf vielfache Weise geschehen und was in der einen Situation hilft, nutzt in der nächsten überhaupt nichts. Es geht nicht darum, „perfekt reguliert“ zu sein, sondern darum, dass du dich selbst wahrnimmst. Und von dort aus erkennst, was DU in dem Moment brauchst und was deinem System guttut. Das braucht Zeit, und ja, manchmal fühlt es sich nach „try and error“ an oder wie zwei Schritte zurück. Bleibe dran und sei dabei so mitfühlend mit dir wie mit deiner besten Freundin oder deinem vierbeinigen Familienmitglied.
[1] Bandura, Albert (1991): Social cognitive theory of self-regulation. In: https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90022-L
[2] Rönnau-Böse, Maike und Fröhlich-Gildhoff, Klaus (2018): Was ist Resilienz und wie kann sie gefördert werden? In: Televizion 31/2018/1. In: https://izi.br.de/deutsch/publikation/televizion/31_2018_1/Froehlich-Gildhoff_Roennau-Boese-Resilienz.pdf
[3] Catanese, Lisa (2024): Self-regulation for adults: Strategies for getting a handle on emotions and behavior. In: https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/self-regulation-for-adults-strategies-for-getting-a-handle-on-emotions-and-behavior?
[4] Zaid, Sumaia Mohammed und Hutagalung, Fonny Dameaty et al. (2025): The power oft emotion regulation: how managing sadness influences depression and anxiety? In: BMC Psychol 13, 38 (2025). https://doi.org/10.1186/s40359-025-02354-3
[5] Förderung der Selbstregulationskompetenzen von Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen und Schulen (2024). Schriftenreihe zur wissenschaftsbasierten Politikberatung: Stellungnahme. In: https://www.leopoldina.org/fileadmin/redaktion/Publikationen/Nationale_Empfehlungen/2024_Stellungnahme_Selbstregulation.pdf
[6] Sachse, Rainer (2020): Selbstregulation und Selbstkontrolle. Göttingen: Hogrefe
Bildnachweis:
FreepikCompany – stock.adobe.com; Krakenimages.com – stock.adobe.com; natali_mis – stock.adobe.com; william87 – stock.adobe.com; Flamingo Images – stock.adobe.com; Roman – stock.adobe.com